#Sanierungsstory
Haus Freund
Nach der Dämmung der Dachschrägen (siehe Beitrag #2) steht in unserer Sanierungsstory für Galina heute ein besonders wichtiges Thema im Fokus: die Dämmung der Wände. Wie wir wissen, liegt „Haus Freund“ idyllisch im Wald, also umgeben von feuchter Natur.
Und genau das bringt Herausforderungen mit sich. Neben der Wärmedämmung geht es bei dieser Sanierungs-Maßnahme daher auch um Feuchtigkeitsregulierung und Schimmelschutz. Dafür hat Galina sich für ein besonderes Material entschieden, das man eher aus der Denkmalpflege kennt: Kalzuimsilikatplatten (s. Infobox unten).
• Ob das eine gute Wahl war,
• ob ihr Zuhause jetzt endlich warm wird
• und was Galina bisher (über sich) gelernt hat?
Das erzählen wir hier.
In unserer Reihe #Sanierungsstory dürfen wir Menschen in Karlsruhe bei unterschiedlichsten (energetischen) Sanierungsprojekten begleiten. Vor welchen Herausforderungen sie stehen? Wie – und ob – sie diese meistern? Erzählen wir hier!
Zum Nachlesen: → Hier geht es zu Teil 1 der Sanierungsstory „Haus Freund“
→ Hier geht es zu Teil 2 der Sanierungsstory „Haus Freund“
Über unsere #Sanierungsstory berichten wir auch auf unseren Social-Media-Kanälen.
Ein Leben ohne kalte Wände
Vor der Sanierung hatten die Wände von „Haus Freund“ mit typischen Problemen zu kämpfen, die durch die Lage mitten im Wald noch verschärft wurden: kalte Flächen, hohe Energieverluste und Feuchtigkeit – ganz besonders in den Ecken. Die Natur vor der Haustür ist wunderschön, aber die ständige Feuchtigkeit ist im Innenraum eine echte Herausforderung.
Warum Kalziumsilikatplatten? Weil sie clever sind!
Kalziumsilikatplatten sind für die Innendämmung ein echter Geheimtipp, besonders wenn Feuch-tigkeitsprobleme das Haus plagen. Das Material kann nämlich mehr als nur dämmen – es arbeitet aktiv mit.
Was macht die Platten so besonders?
- Feuchtigkeitsmanagement: Kalziumsilikatplatten saugen Feuchtigkeit aus der Luft, geben sie aber langsam wieder ab. Das Ergebnis? Immer ein trockenes, angenehmes Raumklima
- Diffusionsoffenheit: Die Platten sind durchlässig für Wasserdampf. So sammelt sich keine Feuchtigkeit in den Wänden – und Schimmel hat es schwer
- Umweltfreundlichkeit: Kalziumsilikatplatten bestehen aus Kalk, Sand und Zellulose – alles natürliche, nachhaltige Materialien
- DIY-tauglich: Galina kann die Platten selbst verlegen, wenn ein Profi ihr zeigt, wie es geht und was sie beachten muss
Natürlich gibt es auch für dieses Material Grenzen: Die Platten machen aus „Haus Freund“ kein Effizienzhaus, und förderfähig sind sie aufgrund ihres U-Werts (bemisst die Wärmedurchlässigkeit; je niedriger, desto besser) ebenfalls nicht. Aber beides ist nicht das Hauptziel für Haus Freund (s. Teil 1 „Sanier’s mal mit Behutsamkeit“)
Workshop for one
Ein großer Teil der Kalziumsilikatplatten wurde im Rahmen eines Workshops im August 2024 angebracht. In der intensiven 1:2-Betreuung durch die beiden betreuenden Handwerkenden lernte Galina nicht nur den Umgang mit Kleber und Kreissäge, sondern auch, wie meditativ und befriedigend diese Arbeit sein kann.
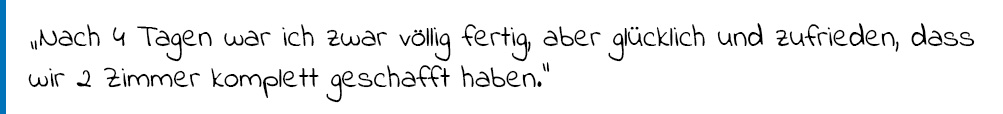
So wird mit Kalziumsilikatplatten gedämmt
Kalziumsilikatplatten werden mit einem speziellen Kleber an die Wand geklebt. Dieser muss so beschaffen sein, dass er mit den Eigenschaften der Platten harmoniert und nicht z. B. die Diffusionsoffenheit behindert. Insgesamt ist die Dämmung mit Kalziumsilikatplatten kein Hexenwerk. Dennoch muss man vorbereitet sein und genau wissen, worauf es dabei ankommt:
1. Wand vorbereiten:
- Schimmel entfernen – sorgfältig, gründlich und endgültig
- Wände begradigen, sodass später unter den Platten keine Luftblasen und Hohlräume entstehen
2. Platten kleben
- Wandabschnitt „einputzen“ per Zahnkelle mit Kleber (Klimaplattenkleber)
- Kalziumsilikatplatte in Gegenrichtung mit demselben Kleber bestreichen
- Platte satt an Wand kleben
3. Oberfläche herstellen
- Wenn die Wand fertig und der Kleber durchgetrocknet ist, kommt eine Kalkgrundierung darauf und dann ein finaler Kalkputz
Übrigens: Wer sich für die Arbeit mit Kalziumsilikatplatten interessiert oder in anderen Bereichen einmal selbst Hand anlegen möchte, ist eingeladen, sich direkt bei Galina zu melden. Wir vermitteln gerne den Kontakt (presse@kek-karlsruhe.de)!
Ergebnis: Der Muff ist Weg, die Wände warm
Mittlerweile sind die Dämmarbeiten weit fortgeschritten und das Ergebnis kann sich sehen, riechen und fühlen lassen. „Riech mal. Der Muff ist weg“, strahlt die Hausherrin als wir in ihrem kleinen Salon stehen. Und tatsächlich ist das Raumklima merklich wohliger als noch bei der Erstbegehung. Die Wände sind nicht kalt, obwohl es mittlerweile November ist – essenziell bei der Schimmelvermeidung.
Galina ergänzt: „Ich heize mittlerweile mit einem einzigen Nachtspeicherofen das komplette Obergeschoss. Das Erdgeschoss schafft es in anderthalb Stunden von 13 auf 20 Grad. Ich kann hier sitzen, ohne zu frieren. Mich an die Wand lehnen, ohne Gänsehaut zu bekommen. Daran war noch im Frühjahr nicht mal zu denken.“
Infobox: Was sind Kalziumsilikatplatten?
Kalziumsilikatplatten bestehen aus Kalk, Sand und Zellulose. Dieses natürliche Material ist besonders für seine feuchtigkeitsregulierenden und schimmelresistenten Eigenschaften bekannt. Ursprünglich wurden sie vor allem in der Denkmalpflege eingesetzt, doch mittlerweile werden sie auch in der Sanierung und Modernisierung von Gebäuden immer beliebter.
Einsatzgebiete:
– Innendämmung von Wänden
– Schimmelsanierung
– Verbesserung des Raumklimas – Optimierung der Raumakustik
Eigenschaften:
– Diffusionsoffen
– Feuchtigkeitsregulierend
– Brandsicher (nicht brennbar)
– Nachhaltig
„Ich kann so leben“ (Galina im Interview)
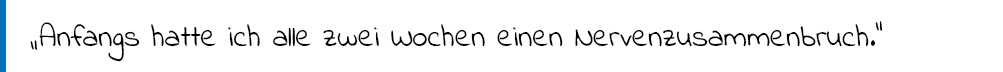
KEK: Galina, du bist jetzt im zweiten Jahr deiner Sanierung „Marke Eigenbau“. Wie erging es dir bisher und wie geht es dir jetzt?
Galina Freund: Ganz ehrlich? Als ich hier eingezogen bin, hatte ich eine Matratze, eine Kochplatte, einen Wasserkanister, einen Pilz im Bad und feuchte Luft in allen Räumen. Anfangs hatte ich alle zwei Wochen einen Nervenzusammenbruch. Beim Sanieren bin ich eine Frau in einer Männerdomäne, habe keine handwerkliche Expertise, anfangs nichtmal Vorerfahrung. Klar mache ich Fehler. Viele. Und genau so viel lerne ich dann halt dazu.
Deine wichtigste Lektion?
Hm, vielleicht: Nicht jeder, der es besser weiß, weiß es wirklich besser. Am Ende muss ich entscheiden, was das Beste für mich und mein Haus ist. Ich will ja hier leben und kenne mein Haus am besten!
Mittlerweile kann ich das – also auf mich selbst hören und mich behaupten. Aber der Weg dahin war wirklich schwer.
Es geht dir jetzt also besser?
Ja, deutlich. Sieh mal: wenn ich um 18:00 nach Hause komme, bin ich durch, wie alle, die voll berufstätig sind. An so einem Abend passiert nicht mehr viel am Haus. Das hat mich am Anfang unglaublich gestresst, dass nicht so viel vorangeht. Seit ich einfach akzeptiert habe, dass ich das nicht ändern kann, kann ich gelassen damit umgehen. Es geht halt nicht schnell, sondern eher langsam. Na und? Ich kann so leben.
Und wie stehts um die Finanzierung? Wir wissen ja, dass vieles von dem, was du gerade tust, nicht förderfähig ist.
Es ist schwer auszurechnen. Ich besorge mir fast alle Materialien selber. Für die Umsetzung bin ich auf mich selbst, wunderbare Freiwillige und das Wohlwollen meiner großartigen Handwerkenden angewiesen. Wenn ich für alle Maßnahmen Fachbetriebe beauftragt hätte … das wäre utopisch. Ich kann also immer nur von Maßnahme zu Maßnahme planen und weiß nie ganz genau, welche Kosten auf mich zukommen.
Wenn sich am Ende zeigen sollte, dass ich mich übernommen habe, dann ist das halt so. Ich weiß, ich habe mein Bestes gegeben und es Stand jetzt echt gut hingekriegt.
Das klingt wirklich gelassen. Was sind denn die nächsten Maßnahmen?
Erstmal die Wände fertig dämmen, es fehlen noch ein Teil des Flurs und Küche. Dann ganz wichtig die Kellerdecke und der Treppenaufgang. Ich will die untere Etage im Sommer fertig haben und auch mit den Fenstern beginnen. Dafür drücke ich alle Daumen.
Neugierig, wie es mit „Haus Freund“ weitergeht? Das erfahren Sie in der nächsten Sanierungsstory. In der Zwischenzeit besuchen Sie uns gerne auch auf unseren Social Media Kanälen.






Fotos: © Sven Ochs (4), Paulina Barton (3)
Die beiden Hauptdarstellerinnen

Galina Freund
Baujahr: 1972
Typ: Schauspielerin
Steht: auf der Bühne und in der Kulturküche
Merkmale: offen und naturverbunden
Zustand: herausgefordert, aber voller Tatendrang
Substanz: robust

Haus Freund
Baujahr: 1924
Typ: ehemaliges Gartenhäuschen
Steht: im Wald bei Karlsruhe
Merkmale: offen und naturnah
Zustand: sanierungsbedürftig
Substanz: robust





